Die folgende Übung kann hilfreich sein, um sich mit den Erwartungen und Anforderungen an eine professionelle pädagogische Fachkraft auseinanderzusetzen und zu reflektieren.
Diese Videopräsentation ist Teil des Angebots "Wir spielen die Zukunft", welches an der pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Frau Prof.in Franziska Vogt erstellt wurde. Es handelt sich um gendersensible, kreative Freispielimpulse zu digitalen Themen, bei denen eine spielerische Auseinandersetzung mit Digitalisierung und digitaler Transformation stattfindet. Zudem wird vermittelt, wie pädagogische Fachkräfte den Prozess sprachlich begleiten können.Diese Videopräsentation bietet Ihnen einerseits einen theoretischen Überblick der Thematik und andererseits sehen Sie vielfältige praktische Beispiele für die Umsetzung im pädagogischen Alltag.
Dieser Impulstext beantwortet zentrale Fragen im Kontext der Begleitung von Kindern mit Fluchterfahrung in Kindertageseinrichtungen: Was sind psychische Traumata und wie entstehen sie? Wie äußern sich diese bei Kindern und wie können wir im pädagogischen Alltag damit umgehen?
Musik und musikalische Momente begleiten Kinder wie Erwachsene in ihrer Alltagswelt. Kinder produzieren Töne auf verschiedenen Höhen, erfreuen sich an Klängen, lassen sich durch Musik faszinieren oder auch beruhigen. Im deutschsprachigen Kulturraum sind Musikaktivitäten der ersten Bildungsjahre aber wenig verankert. Dies steht ganz im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, in welchen Musikaktivitäten längst in Konzepte und Leitlinien des frühkindlichen Bildungsbereichs integriert sind (Stadler Elmer, 2013). Hier setzt das Projekt «MumiK» – Musizieren mit Kindern – an. Es beforscht das kindliche Muszieren in den ersten Bildungsjahren im institutionellen Rahmen. Die Stichprobe umfasst 5 Kitas und 3 Kindergärten des deutschen Sprachraums. Neben Erkenntnissen aus der Literatur, stellen Interviews und halbstandardisierte musikalische Praxissequenzen die Datenbasis der Untersuchung dar. Die Auswertung umfasst den vorliegenden Bericht sowie Filmaufnahmen der verschiedenen didaktischen Settings im Altersvergleich. Die Analysen der Daten zeigten, dass eine musikalische Förderung der Kinder in den ersten Bildungsjahren im institutionellen Rahmen leicht zu bewerkstelligen ist. Bereits die kleinen Kinder musizieren erfolgreich, wenn sie die Möglichkeit dazu erhalten und viele Wiederholungen stattfinden können. Sie lernen durch Imitation und soziale Interaktionen. Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren gelingt es bereits nach wenigen Durchgängen im sozialen Kontext verschiedene Parameter zu koordinieren.
Kinder sollen im Alltag erfahren, dass sie mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Emotionen ernst genommen werden und wesentliche Belange in ihrem Alltag mitbestimmen können und dürfen. Um dies zu ermöglichen, bedarf es der Unterstützung der Personen, die ihren Alltag gestalten und begleiten.Eine wesentliche Rolle bei der Beteiligung von Kindern im Alltag spielt die partizipative Gestaltung der Kommunikation, z. B. den Kindern zuzuhören, sie durch Fragen mit einzubeziehen und nicht Antworten vorzugeben. Diese interaktive Präsentation kann als Ergänzung zur Checkliste "Partizipative Sprache" verstanden werden. Die Präsentation erläutert die in der Checkliste aufgeführten Kriterien und die jeweiligen theoretischen Hintergründe.
Diese Vorlage eines Netzwerkhandbuchs, welches im Kontext der Begleitung von Kindern mit Fluchterfahrung relevant sein kann, dient dazu relevante Unterstützungsstellen in Ihrer Region zu sammeln und bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.
Kindertageseinrichtungen sollen Orte sein, an denen Kinder die Anerkennung ihrer Person erfahren. Sie sollen Selbstwirksamkeit erleben und selbstbestimmt an den Entscheidungen in für sie relevanten Themen beteiligt werden.In diesem Interview mit Prof.in Dr.in Frauke Hildebrandt wird der Frage nachgegangen wie eine solche Beteiligung ausgestaltet sein sollte. Frauke Hildebrandt ist Professorin für Forschung und Praxisentwicklung an der Fachhochschule Potsdam sowie Leiterin des kooperativen Masterstudiengangs „Frühkindliche Bildungsforschung“ der Fachhochschule Potsdam und der Universität Potsdam. Sie forscht u. a. zu den Schwerpunkten kognitiv-anregende Interaktionen sowie Sprachbildung und Partizipation in Kindertageseinrichtungen.Das Interview bearbeitet Fragen wie: „Was bedeutet Partizipation in der Kindertageseinrichtung und warum ist sie so bedeutsam?“ „Was hat Partizipation mit Sprache zu tun?" Dadurch wird reflektiert, wie Kinder Anerkennung ihrer Person erfahren und sie sich an selbstbestimmenden Entscheidungen beteiligen können.
In diesem Fachtext geht es darum wie Kinder ihre naturwissenschaftsbezogene Bildung im Elementarbereich entwickeln.
Diese Linkliste ermöglicht einen ersten Überblick über relevante Angebote und Materialien zum Umgang mit Flucht und Trauma im pädagogischen Kontext, die bei Fragen im Kontext der Begleitung von Familien und Kindern mit Fluchterfahrung herangezogen werden können. Die Materialsammlung soll zudem zur Auseinandersetzung mit der Thematik anregen und gleichzeitig hilfreiche Unterstützungsstellen allgemein sowie in den einzelnen Bundesländern auflisten.

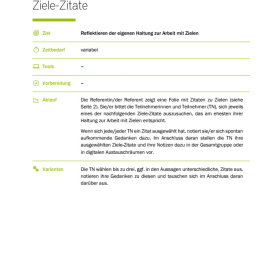
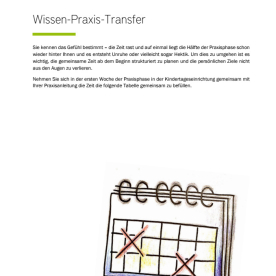

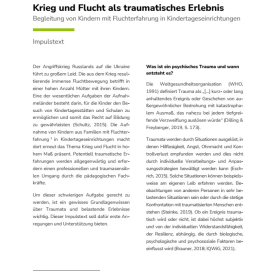



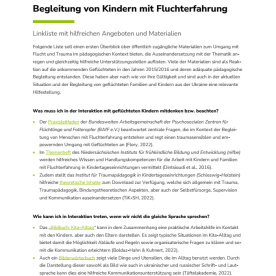
Die Methode zielt darauf ab, die eigenen Haltung zur Arbeit mit Zielen zu reflektieren.