Dieser Bericht bezieht sich auf die qualitative Auswertung offen gestellter Fragen eines Fragebogens, der anlässlich einer Eltern- und Fachkräftebefragung zur Entwicklung eines europäischen Gütesiegels für Kindertageseinrichtungen erhoben wurde. Insgesamt wurden 469 Fragebögen österreichischer Eltern retourniert. Davon wurden in 397 Fragebögen offene Antworten ausgefüllt (84,65 %). Alle Nennungen der Eltern verteilen sich auf die vier Oberkategorien Pädagogische Strukturqualität, Orientierungsqualität, Prozessqualität und Qualität des Familienbezuges, und deren Subkategorien. Wird die Zuteilung aller Nennungen nur auf der Ebene der Oberkategorien betrachtet, wird deutlich, dass die Prozessqualität mit über 83% mit erheblichem Abstand vorne liegt. Dieses Ergebnis spiegelt die Aussagen wieder, dass die Prozessqualität und dabei insbesondere die Interaktionsqualität das Kernstück der pädagogischen Arbeit darstellt (Tietze, Bolz, Grenner, Schlecht & Wellner, 2007).
Angebote der Frühen Förderung sehen in verschiedenen Schweizer Städten unterschiedlich aus, Zugangserleichterungen oder auch verpflichtende gesetzliche Grundlagen zur Teilnahme an einer Maßnahme ebenfalls. Bis anhin ist weitestgehend unklar, wie die Familien – im Speziellen sozial benachteiligte Familien und Familien mit Migrationshintergrund – den unterstützenden Zugriff des Staates empfinden. Die Studie untersuchte die Nutzung (oder auch Nicht-Nutzung) und den Nutzen von Angeboten aus Sicht der Eltern. Dies geschah vergleichend über verschiedene Gemeinden und Städte hinweg.
Dossier zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Bildungsbereich Bildnerisches Gestalten
Dossier zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Bildungsbereich Grobmotorik
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Wirkung einer entsprechenden Weiterbildung zur Verbesserung der Interaktionsqualität und analysiert, ob durch den Besuch des Hochschullehrgangs „Alltagsintegrierte Sprachförderung“ – der im Sommersemester des Studienjahres 2020/21 initiiert wurde – Effekte in der Interaktionsqualität (sowohl subjektiv eingeschätzt als auch beobachtet) festgestellt werden können. In dem nun vorliegenden Bericht sollen die Ergebnisse der längsschnittlichen Untersuchung der Interventions- und Kontrollgruppe abgebildet und diskutiert werden.
Arbeitsmaterial für Aus-, Fort- und Weiterbildungen, Teamsitzungen & Elternabende. Es handelt sich um ein länderübergreifendes Projekt, das die Qualität institutioneller Bildung, Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinstkindern im Alter von null bis zwei Jahren in Graz und Zürich untersucht. Ziele des Projekts sind die Qualitätsentwicklung und -Sicherung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Säuglingen und Kleinstkindern in institutionellen Einrichtungen und zwar insbesondere in Spielsituationen. Dazu sollen die vorhandenen Expertisen aus Theorie und Wissenschaft sowie die bereits umgesetzte gute Qualität in Einrichtungen herangezogen und in einem praxisorientierten Kriterien-Leitfaden zusammengefasst werden. Videos samt methodisch aufbereitetem Begleitheft (mit Reflexions- und Praxisübungen für das Personal in den Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen) sollen eine Brücke zwischen dem Leitfaden und der Implementierung der Kriterien in der Praxis bilden.
Dossier zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Bildungsbereich Feinmotorik
Beobachtung und Interpretation kindlichen Verhaltens und Könnens sind seit jeher bedeutsame Elemente beruflichen Handelns im Elementarbereich und avancierten in den letzten Jahren zu einer der Kernaufgaben der Fachpersonen (Viernickel 2011; Steudel 2008; Ulber/Imhof 2014; Leu 2008). Das Beobachten, Dokumentieren und darauf aufbauende Planen sind Ausdruck eines konsensfähigen Bildungsverständnisses, das die Individualität des Kindes und seine Entwicklung fokussiert (Wildgruber/Becker-Stoll 2011). Dies ist daher in allen Bildungs- und Lehrplänen für die Arbeit im Elementarbereich als professionelles Handlungsfeld beschrieben (z.B. Niedersächsisches Kultusministerium 2011; Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 2014; Bildungsdirektion Kanton Zürich 2008; Wustmann Seiler/ Simoni 2012). Eine aussagekräftige Beobachtungsdokumentation wird generell empfohlen, konkrete handlungspraktische Hinweise dazu sind allerdings in den Rahmenplänen selbst nicht beschrieben. Der Beobachtungs- und Dokumentationsauftrag muss individuell von jeder Fachperson interpretiert werden, was sowohl die Gestaltung der Beobachtung und deren Verschriftlichung als auch die Wahl des Instrumentes selbst zur Erfassung von Beobachtungen miteinschließt.
Dossier zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Bildungsbereich Natur

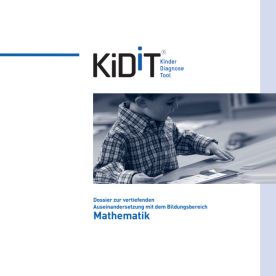

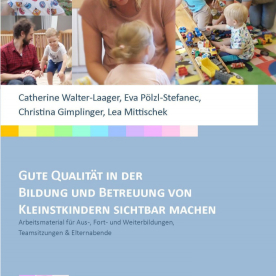
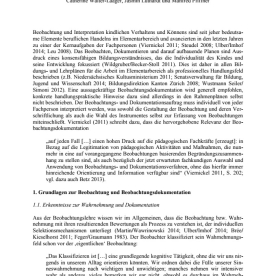
Dossier zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Bildungsbereich Mathematik